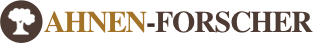Startseite › Foren › Forschungsgebiet Ost- und WestpreußenNeu › Kreis Heiligenbeil – Heimatgeschichtliches aus Zeitungen › Antwort auf: Kreis Heiligenbeil – Heimatgeschichtliches aus Zeitungen
Die Kirchenbücher unseres Kreises
Heiligenbeiler Zeitung, Von Schulz – Rosenberg /78
Zu den wichtigsten Quellen der Heimatgeschichte gehören zweifellos die Kirchenbücher. Dem liebevollen Entgegenkommen der Geistlichen habe ich es zu verdanken daß ich die Kirchenbücher der Kirchen, die für die Erforschung der Geschichte meiner Vorfahren in Betracht kommen, selbst studieren durfte. Erst seit Einführung der Reformation gibt es in unserer Provinz Kirchenbücher. Man rechnet dazu Tauf-, Heirats-, Toten- oder Leichenbücher und Beichtbücher. Sie waren nötig, um die Anhänger der Neuen Lehre im Auge zu behalten. Die allgemeine Einführung wurde 1573 angeordnet, indessen beginnt das älteste bis jetzt erhaltene Kirchenbuch das Taufbuch von Eisenberg erst 1596. Die älteren Bücher sind in Schweinsleder gebunden, die Schrift des Titelblattes ist oft recht kunstvoll mit der Gänsefeder, die sich jeder Schreiber selbst zuschnitt, in verschiedenen Farben gezeichnet. Die Schrift der Eintragungen ist meist in gotischen Buchstaben gehalten. Wenn man bedenkt, daß das Pfarrhaus, die Widdem, einst genau so ein Rauchhaus war wie jedes Bauernhaus und der Herr Pastor sein „Studierstüblein“ auch mit einem Öllämpchen, einem Talglicht oder einer Wachskerze beleuchtete, dann wird der Leser leicht einsehen, daß die Bücher im Laufe der Jahrhunderte stark verräucherten. Die Blätter vergilbten und die Schrift wurde blaß, so daß sie mancherorts nur von einem scharfen mit der Lupe bewaffneten Auge zu erraten ist. Da die Gelehrtensprache einst das Lateinische war, sind viele Ausdrücke lateinisch, so daß derjenige, der nicht lateinisch kann, sich erst alle Fachausdrücke fest einprägen muß, wenn er die Kirchenbücher studieren will. Auch den kirchlichen Kalender muß er beherrschen. Vor der ersten Eintragung im neuen Jahre steht oft ein schöner Segenswunsch. Die Jahreszahlen und Monate sind oft in verschiedenen Farben schön gemalt, ein Zeichen, daß der Schreiber vielleicht viel Zeit hatte. Vor der ersten Eintragung von 1756 steht mit rücksicht auf den damals ausgebrochenen 7-jährigen Krieg fast überall der spruch: „Gott gib Fried in deinem Lande, Glück und Heil zu allem Stande.“
In der ältesten Zeit wurde bei den Eintragungen auf die Abstammung des Betreffenden wenig Rücksicht genommen. Hauptsache war Feststellung der Zahl der Getauften, der Getrauten und der Verstorbenen, infolgedessen sind die Eintragungen anfangs recht kurz gehalten. Zuweilen hat der Pfarrer den Vornamen des Kindes gar nicht eingetragen, die Lücke dafür ist vorhanden. Bei Getrauten fehlt der Name der Mutter, der Geburtstag des Kindes, ja bisweilen auch der Name des Vaters, wenn es in dem Orte nur einen Mann mit dem betreffenden Berufe gab. Da aber die Paten eine Gabe an den Pfarrer, den Kantor und den Glöckner zu entrichten hatten, so sind sie genau nach Vor- und Familiennamen, Stand, Freier Kölmer, Bauer, Knecht, Losmann und Wohnort aufgeführt, oft über 20 an der Zahl. Die Taufe fand spätestens am 3. Tag nach der Geburt statt, da die Verwandten oft meilenweit entfernt in verschiedenen Himmelsgegenden wohnten, wurden sie durch reitende Boten geladen.
Der Tag der Taufe ist nach dem kirchlichen Kalender angegeben, z.B. Dienstag nach dem 1. Advent ließ der Müller aus der Bahnauschen Mühle einen jungen Sohn George taufen. Die Paten sind gewesen usw… oder Mittwoch in der stillen Woche ließ ein katholischer Kerl aus Schipperbahnau in Heiligenbeil einen Sohn taufen, Johannes.
Die unehelich geborenen Kinder wurden früher in den Kirchenbüchern quer oder umgekehrt eingetragen. Wurde ein Kind früher als neun Monate nach der Heirat geboren, so wurde das meistens vermerkt. Während einzelne Pfarrer die Trauungen recht ausführlich eintrugen, kürzten manche so sehr, daß der Forscher nicht viel mit solchen Eintragungen anzufangen weiß. Die Mütter von Braut und Bräutigam werden fast nie genannt, z.B. in Eichholz am 15.11.1677 ist copuliert Georg Schultz mit Jfr Regina Tiedemann. Ausführlicher ist eine andere Eintragung: Bladiau am 11.November 1777 ist getraut worden Ludwig Böhm, köllmischer Freie und einziger Sohn des Ludwig Böhm, Köllmers zu Quilitten mit Jfr Charlotte Walterin, des Eigentümers George Walter in Bladiau einzige Tochter. Der Bräutigam 27 Jahre, die Braut 19 Jahre alt.
Im Buch erl. Brautleute, die in Unehre gelebt hatten, wurden nicht getraut, sondern ehelich zusammen gegeben in der Widdem (Pfarrhaus), in der Sakristei (Betkammer) oder unter dem Glockenturme in der Halle. Indessen war die Zahl solcher Brautleute erheblich geringer als heute. In Eisenberg sind in einem Anhange zum ältesten Traubuche alle die Personen aufgeführt, die wegen Übertretung des sechsten Gebotes öffentlich Kirchenbuße tun mussten, indem sie an drei Sonntagen im Halseisen stehen mussten. In Lindenau ist das Halseisen hoch heute am Turm zu sehen, in Waltersdorf sind nur noch die Reste vorhanden. Friedrich der Große hob diese Art der strafen auf, um das Volk nicht zu verbittern. //
Am Kürzesten sind ursprünglich die Eintragungen in den Toten- oder Leichenbüchern. Nicht der Todestag sondern der Begräbnistag ist angegeben. Gewöhnlich wurde wegen der Einnahme vermerkt, ob der Tote still, mit Ablesung oder einer Leichenpredigt begraben wurde. Auch hier lässt sich mit einer Eintragung wie der folgende nicht viel anfangen: Am Freitag nach Ostern 1695 wurde der alte Dorfshirt gratis begraben, Bisweilen ist die Eintragung recht ausführlich und für den Entschlafenen ehrend, obgleich er, wie die Akten in den Archiven beweisen, es oft mit den Gerichten zu tun hatten, z.B. Eisenberg 1725: Am 3. Dezember ist der alte George Schulz in Eisenberg im 84. Jahr seines Alters von dieser Welt geschieden, nachdem er 2 Tage zuvor auf seine Bitten mit dem heiligen Abendmahl gestärket worden und am 7. begraben worden mit einer Leichenpredigt. In Balga sind die Todesfälle, die infolge eines Unglücksfalles einträten, in einem Anhange aufgeführt. Gesondert sind auch die aufgeführt, die infolge gerichtlichen Urteils gerädert, ersäuft oder verbrannt wurden. Balga war einst Sitz der höchsten Verwaltungs- und Gerichtsbehörde des Amtes Balga, dem der größte Teil des Kreises angehörte. Vornehme Leute wurden bis etwa 1750 in der Kirche bestattet.
Was lernen wir aus den Kirchenbüchern? Unser Kreis war einst viel dünner bebölkert als heute. Im Kirchspiel Eisenberg wurden um 1600 jährlich nicht viel mehr als 10 Kinder getauft. Vor ausbruch des Krieges werden es wohl reichlich 100 gewesen sein. Die Landesfürsten hatten damals Mühe, für die wüst liegenden Bauernhöfe Bauern zu finden. An Vornamen waren unsere Vorfahren vor zweihundert Jahren sehr arm. Man Kannte nur die Namen Michael, Johann, Jakob, Christoph, Christian, Georg, Peter, Jakob, Regina, Anna, Elisabeth, Dorothea, Gertrud und Johanna. Andre Namen waren eine Seltenheit. Eigenkätner wurden erst nach 1700 auf dem Dorfanger angesiedelt. Die Menschen sind vor 200 Jahren im Durchschnitt nicht älter geworden als heute. Auch die Kindersterblichkeit war recht groß. Geheiratet wurde meist im Alter bis zu 25 Jahren. Witwer und Witwen heirateten wieder, wenn sie nicht schon sehr alt waren, und das Grundstück erhielt regelmäßig ein Kind aus der zweiten Ehe. Uneheliche Geburten waren verhältnismäßig seltener wie heute. Vetter und Base lassen sich fast nirgens trauen. Trotzdem gibt es bei der ansessigen Bevölkerung des Kreises nicht zwei Personen, die nicht gemeinsame Vorfahren haben, die also verwandt sind, wenn ihre Vorfahren sowiet erforscht werden, als die Kirchenbücher zurückreichen, gleichviel welchem Stande sie angehören.
Wenn eine Familie anscheinend in einem Kirchspiel ausstirbt, breitet sie sich im anderen um so mehr aus. Kriegerische Ereignisse spiegeln sich hier selten wieder, wohl aber ansteckende Krankheiten, die meist infolge von Kriegen und Hungersnot auftraten. 1758 am 11. Februar taufte der Pfarrer ein Kind in seinem Hause, da eben die Kosaken ins Dorf Bladiau eingerückt waren.
Im Buch enth. Die Pest scheint 1709 nur in einem Dorfe des Kirchspiels Bladiau und in Einsiedel, Kirchspiel Grunau viele Opfer gefordert zu haben. Grunau, den 10., 11., 12. und 13. August: Die in dem Einsiedel 22 folgende Personen sind sehr schleunig an der Pest gestorben und gleich ohne Sarg daselbst in die Erde verscharret worden, und zwar aus drei Häusern, die hiernach in Brand gestecket worden. 1. Witten Haus, daran der Mann, das Weib nebst 6 Kindern einem Knecht und armen Soldaten. 2. Harders Haus, nachdem sein Weib den 12. August und mit einer Leichenpredigt doch unwissend, daß an der Pest sein sollte, begraben worden, so sei ihr gefolget so an der Pest gestorben zwei erwachsene Söhne, ein lediges Weib, eine Marjell, der Mann allein ist von der Pest genesen. 3. Hasen Haus: der Mann, sein Weib, die Kinder, ein lediges Weib, die Magd als ihre Schwester, ein Knecht.
Die Kirchenbücher sind selten lückenlos, es fehlen einzelne Jahrgänge, die verloren gegangen sind. Die ältesten Tauf-, Heirats- und Totenbücher beginnen nach Angabe des Konsistoriums:
Kirchspiel Taufbücher, Heiratsbücher, Totenbücher
Balga *1715, oo1715, +1715 lückenlos
Bladiau *1705 (1736), oo1705, + 1705 lückenlos
Eichholz *1668, oo 1668, + 1772
Eisenberg *1595, oo 1684, + 1675
Grunau u Alt Passarge *1637, oo 1637, + 1681
Heiligenbeil *1602, oo 1602, + 1706
Hermsdorf – Pellen *1694, oo 1720, + 1720
Hohenfürst *1676, oo 1676, + 1676 lückenlos
Lindenau *1646, oo 1693, + 2669
Pörschken *1665, oo 1662, + 1758
Dt. Thierau *1676 (1751), oo 1676 (1751), + 1676 (1751) lückenlos
Tiefensee *1739, oo 1742, + 1742 lückenlos
Waltersdorf *1664, oo 1664, + 1664
Zinten *1664, oo 1716, + 1716
In die Beichtbücher werden die Abendmahlsgäste eingetragen. Strenggläubige christen gingen früher wohl alle 6 Wochen zum Tisch des Herrn. Der Geistliche konnte einst, als die Seelenzahl der Gemeinden noch erheblich kleiner war, die Gemeindeglieder auf Grund der Beichtbücher alle im Auge behalten.
Ein fischerwirt aus Follendorf wurde 1737 still begraben, weil er ein Jahr lang nicht zum Abendmahl gewesen war. Sein Name ist nicht genannt.